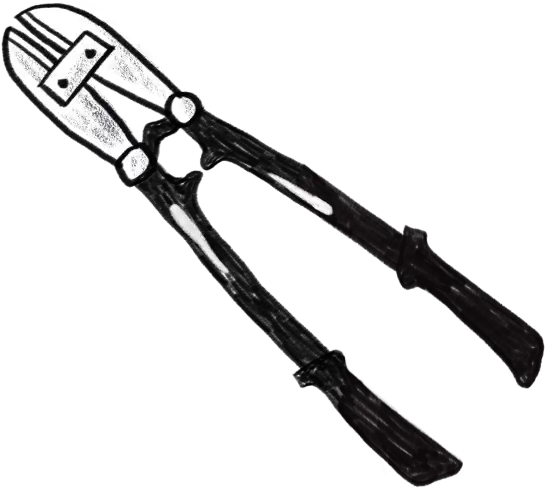Seit den frühen 1990er-Jahren findet im Gedenken an die antisemitischen Novemberpogrome von 1938 jährlich der antifaschistische und antirassistische Ratschlag in Thüringen statt. Die Veranstaltung dient der Vernetzung aktiver Antifaschist*innen sowie dem Austausch über inhaltliche und strategische Fragen. Seit über drei Jahrzehnten bringt der Ratschlag dabei Engagierte aus Gewerkschaften, antirassistischen, antisemitismuskritischen, feministischen und antifaschistischen Initiativen, Bürger*innenbündnissen, Jugendverbänden, Parteien sowie aus linken und linksradikalen Zusammenhängen zusammen. Der 34. Ratschlag findet am 7. und 8. November 2025 in Jena statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, teilzuhaben, sich einzubringen, zu diskutieren und neue Kontakte und Bündnisse zu knüpfen. Wenn ihr noch genauer wissen wollt, warum der Ratschlag so wichtig ist, was uns beschäftigt und warum wir uns freuen würden, euch auf dem Ratschlag zu sehen, hier noch ein Einblick unsererseits.
Warum Jena?
Die Stadt war im Nationalsozialismus ein ideologisches Zentrum, ein Standort von Verfolgung und Ausbeutung sowie ein Ort, an dem sich staatliche Gewalt und gesellschaftliche Unterstützung für das NS-Regime manifestierten: Die NSDAP erreichte in Jena bei den Reichstagswahlen 1930 und 1933 regelmäßig Zustimmungswerte über 30 Prozent. Viele Bürger*innen unterstützten offen nationalistische, antisemitische und autoritäre Ideologien. Die Universität Jena betrieb rassistische und eugenische Forschung und lieferte pseudowissenschaftliche Legitimation für die Verfolgung und Vernichtung von Jüdinnen*Juden und anderen Menschen. Die jüdische Bevölkerung in Jena wurde systematisch entrechtet, isoliert und unter unmenschlichen Bedingungen in einem Barackenlager zusammengepfercht, welches als Zwischenstation vor den Deportationen in Vernichtungslager diente.
Jenas Wirtschaft profitierte massiv von der Ausbeutung von Zwangsarbeiter*innen, insbesondere in der Optik- und Feinmechanikindustrie bei Carl Zeiss und Schott. Im Sommer 1944 wurde ein Außenlager des KZ Buchenwald für das Reichsbahnausbesserungswerk errichtet. Im April 1945 führten SS und Polizei einen Todesmarsch von KZ-Häftlingen aus Buchenwald durch Jena. Viele Gefangene starben während des Marsches, teilweise ermordet in den Straßen der Stadt. Große Teile der Bevölkerung, städtische Behörden und Wirtschaft unterstützten aktiv oder passiv die Durchführung dieser Verbrechen.
Die nachträglichen Befürworter*innen solcher Taten sind in ganz Europa im Aufwind. So auch in Ungarn, wo jedes Jahr tausende Neonazis beim Tag der Ehre in Budapest dem Nationalsozialismus und seinen Täter*innen huldigen. Aufgrund antifaschistischen Engagements gegen diese Veranstaltung ist Jena in den Fokus staatlicher Repression geraten. Mehreren Antifaschist*innen aus unserer Stadt wird vorgeworfen, an Auseinandersetzungen in Budapest beteiligt gewesen zu sein. Unsere Solidarität gilt den von Repression betroffenen Antifaschist*innen, auf deren Situation wir aufmerksam machen wollen. Seit der rechtswidrigen Auslieferung an Ungarn im Juni 2024 befindet sich Maja unter menschenunwürdigen Haftbedingungen in ungarischen Gefängnissen. 23 Stunden täglich allein in einer acht Quadratmeter großen Zelle ohne Kontakt zu anderen Inhaftierten, permanente Videoüberwachung, völlig unzureichende Ernährung und unhygienische Zustände, regelmäßige Durchsuchungen, teils unter vollständiger Entkleidung. Maja trat im Juni für 40 Tage in einen Hungerstreik, um gegen die Zustände der Inhaftierung und die anhaltende Isolationshaft zu protestieren sowie die Rückkehr nach Deutschland einzufordern.
Im Januar stellten sich zudem sieben antifaschistische Genoss*innen nach fast zwei Jahren im Untergrund den Repressionsbehörden, nachdem unter Hochdruck nach ihnen gefahndet worden war. Dass antifaschistisches Engagement kriminalisiert wird, während rechte Netzwerke enormen Zulauf erhalten und neonazistische, rassistische und antisemitische Straftaten auf einem neuen Höchststand sind, ist nicht hinnehmbar.
Das rechtsterroristische Netzwerk des NSU hat seine Wurzeln in Jena. Hier organisierten sich in den 1990er-Jahren die späteren Haupttäter*innen in der neonazistischen Szene, insbesondere im „Thüringer Heimatschutz“. Trotz früher Hinweise auf ihre Gefährlichkeit konnten sie untertauchen und begingen zwischen 2000 und 2007 zehn vorwiegend rassistische Morde, mehrere Sprengstoffanschläge und zahlreiche Raubüberfälle. Die enge Verstrickung des Netzwerks in ein unterstützendes Umfeld sowie das Versagen staatlicher Institutionen bei der Aufklärung werfen bis heute schwerwiegende Fragen auf. Klar ist heute: Der NSU war nicht zu dritt. Es ist nicht hinnehmbar, dass Beate Zschäpe nun in ein Aussteigerprogramm aufgenommen ist und damit Zugang zu Maßnahmen erhält, die ihre Haftbedingungen positiv beeinflussen könnten, während Angehörige der Opfer bis heute auf vollständige Aufklärung warten. Gerade für die Betroffenen und Familien der NSU-Morde ist dies ein Schlag ins Gesicht: Viele von ihnen wurden jahrelang kriminalisiert, von Polizei und Behörden verdächtigt und mit ihren Forderungen nach Wahrheit und Gerechtigkeit allein gelassen. Bis heute werden Hintergründe, Netzwerke und staatliches Versagen nicht konsequent aufgearbeitet sowie die Akten jahrzehntelang unter Verschluss gehalten. Dass der Staat nun Täter*innen Zugeständnisse macht, während die Opfer und ihre Angehörigen weiter um Anerkennung und Unterstützung kämpfen müssen, zeigt, wie sehr sie im Stich gelassen wurden – und wie dringend ein Bündnis zwischen antifaschistischen und antirassistischen Kämpfen ist.
Gegenwärtig wachsen in ganz Deutschland neue neonazistische Jugendgruppen, die teils lose, teils straff organisiert, in sozialen Netzwerken präsent sind, gewaltbereit auf der Straße agieren und sich in Gedenkstätten zunehmend selbstbewusst inszenieren. Immer mehr Rechte organisieren sich in Kampfsportgruppen, trainieren körperliche Angriffe und zelebrieren soldatische Männlichkeit bei Kampfsportevents. Hinzu kommt ein digitales Umfeld, das rechte Ideologien systematisch verbreitet und normalisiert – über Social Media und Influencer*innen aus dem neurechten Milieu. Diese Akteur*innen knüpfen dabei an die Lebenswelt junger Menschen an, nutzen Ästhetiken aus Popkultur und Fitness-Szene, spielen mit Jugendkulturen und Fußball-Ästhetik, bedienen jedoch durchgehend antisemitische, rassistische, trans- und queerfeindliche sowie antifeministische Narrative. Mit schwerwiegenden Folgen: Es bilden sich auch in Thüringen terroristische Jugendgruppen wie die „Letzte Verteidigungswelle“, die in Ostthüringen einen Anschlag auf eine Asylbewerber*innenunterkunft plante.
Gegen jeden Antisemitismus!
Fast die Hälfte aller gemeldeten antisemitischen Straftaten in Thüringen wurden 2024 in Jena begangen. Nicht nur die extreme Rechte propagiert Antisemitismus und bedient autoritäre Sehnsüchte. Der 7. Oktober wirkt ganz im Sinne der Täter nach. Im letzten Jahr stieg die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland weiter an. Es gab einen Anstieg von fast 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders auffällig war die Anzahl israelbezogener antisemitischer Vorfälle, die sich mehr als verdoppelte. Antifaschismus muss sich der Gefahren der gegenwärtigen antizionistischen Mobilisierungen bewusst sein. Thüringen und dabei nicht zuletzt Jena galten über viele Jahre als Regionen mit einer starken antisemitismuskritischen Linken. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, den Novemberpogromen und der Shoah waren wesentlicher Kern antifaschistischen Engagements. Diese Auseinandersetzungen sind längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Das stellt uns vor Fragen: Hat die Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Nationalsozialismus und seinen Kontinuitäten zunehmend an Bedeutung verloren? Welche Brüche haben im gemeinsamen Verständnis von Antifaschismus stattgefunden? Warum sind Antisemitismuskritik, das Wissen um die Spezifika des Antisemitismus und die Präzedenzlosigkeit der Shoah mitunter scharfen Anfeindungen auch aus linken Kreisen ausgesetzt? Haben Corona-Lockdowns, die Politisierung junger Leute jenseits klassischer antifaschistischer Strukturen, die Fluktuationen der Universitätsstadt, die fortschreitende Ritualisierung der Erinnerungskultur oder das Ende der Zeitzeug*innenschaft ihre Spuren hinterlassen? Sind Errungenschaften geschichtsbewusster Reflexionen in die Defensive geraten, während die globalen Krisen auch in Jena autoritäre Ideologien und Antisemitismus befeuern? Welche anderen Erklärungen gibt es?
Mit den regelmäßigen antizionistischen Mobilisierungen in der Innenstadt ist eine Zusammenarbeit zwischen pro-islamistischen, antiimperialistischen und linksautoritären Gruppen und eine neue Qualität zu verzeichnen. Der Terrorangriff der Hamas wird verharmlost, auf Demonstrationen mit teilweise mehreren hundert Teilnehmenden zu antisemitischer Massengewalt in Form einer neuen “Intifada” aufgerufen, antisemitismuskritische Plakate und Aufkleber werden in Jena mit Terrorzeichen der Hamas überschmiert, Antifas bedroht, verfolgt und vereinzelt angegriffen. Diese fortschreitende Entwicklung hat in unserer Stadt ein Klima geschaffen, in welchem sich Jüdinnen*Juden und antisemitismuskritische Antifas nicht mehr sicher fühlen können. Das enorme Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung, die schrecklichen Verluste an Menschenleben und die sich im Zuge des Krieges zwischen der Hamas und Israel dramatisch schlechten humanitären Situation dürfen nicht für antisemitische Stimmungsmache und Gewalt instrumentalisiert werden. Daneben bleibt eine friedensorientierte Perspektive weitgehend unsichtbar, die sich nicht auf einseitige Schuldzuweisungen gegen Israel beschränkt, sondern die verschiedenen Akteur*innen und die geopolitischen Kontexte berücksichtigt.
Die Katastrophe des 7. Oktobers und seine genozidale Dimension entschwinden derweil bereits aus dem Bewusstsein. Anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome von 1938 muss auch daran erinnert werden, dass der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 der größte Angriff auf Jüdinnen*Juden seit dem Ende der Shoah gewesen ist. An keinem anderen Tag seit 1945 wurden so viele Jüdinnen*Juden ermordet. Der Ratschlag gedenkt auch dieser Opfer, erinnert an das Schicksal der verbliebenen Geiseln, verurteilt Antisemitismus in all seinen Formen und sieht in den seit Oktober 2023 eklatant ansteigenden antisemitischen Vorfällen und Übergriffen ein Problem, dem wir neue Strategien entgegensetzen müssen. Jeder rassistischen Externalisierung des Antisemitismus erteilen wir eine Absage. Eine Vielzahl antisemitischer Vorfälle aus dem konservativen und rechten Lager und die Verbreitung antisemitischer Überzeugungen in allen Bereichen der deutschen Gesellschaft zeigen, die Behauptung, Antisemitismus sei “importiert” ist sowohl geschichtsvergessen als auch offenkundig rassistisch. Die menschenfeindlichen Konzepte von Abschiebung und “Remigration” sind niemals akzeptable Reaktionen auf gesellschaftliche Missstände.
Menschenfeindlichkeit und reaktionäre Kräfte im Aufwind.
Bei den letzten Bundestagswahlen hat die völkische AfD deutlich an Zustimmung gewonnen. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg lag sie bei den Zweitstimmen klar vorn. Die Zahl rassistischer, queerfeindlicher und antisemitischer Angriffe geht Hand in Hand mit hohen Zustimmungswerten für die AfD. Gleichzeitig greifen andere Parteien die Positionen der AfD auf oder kooperieren mit ihr. Die AfD und die ihr entgegengebrachte Akzeptanz zerstören damit nicht nur demokratische Errungenschaften, sondern schaffen reale Angsträume für viele Menschen in diesem Land.
In den vergangenen Monaten kam es bundesweit vermehrt zu Angriffen und organisierten Protesten gegen Veranstaltungen im Rahmen der CSD-Bewegung. Die Vorfälle reichen von gezielten Störungen und Bedrohungen bis hin zu körperlichen Angriffen auf Teilnehmende. In mehreren Städten traten rechte Gruppen in Erscheinung, darunter bekannte Akteur*innen aus der extremen Rechten und der neuen rechten Jugendkultur, ebenso wie christlich-fundamentalistische und verschwörungsideologische Netzwerke. Insgesamt steht die Sichtbarkeit von LGBTQIA+, für die CSDs seit Jahrzehnten stehen, zunehmend unter Druck. Die Gewalt und Ablehnung gegen queere Lebensrealitäten spiegelt sich in einem gesamtgesellschaftlichen Klima wider, in dem rechte Akteur*innen gezielt gegen Gleichstellungspolitik und sexuelle Selbstbestimmung mobilisieren.
Die politische und gesellschaftliche Landschaft zeigt eine zunehmende Tendenz zur Retraditionalisierung von Geschlechterrollen und Familienstrukturen. Rechte Akteur*innen propagieren und verklären ein patriarchales Familienbild. Diese Ideologie wird nicht nur auf politischer Ebene vorangetrieben, sondern auch verstärkt über Social Media verbreitet, wo antifeministische und sexistische Narrative als angebliche Natürlichkeiten und vermeintliche Wahrheiten verbreitet werden. In Jena treten derweil die völkischen Männerbünde der Burschenschaften selbstbewusst auf. Diese Entwicklungen fördern eine Kultur der Ungleichheit und begünstigen Gewalt gegen Mädchen und Frauen – einhergehend mit einem Anstieg von Femiziden. Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau mit gezielter Gewalt ums Leben gebracht. Gegen diese Zustände sind feministische und emanzipatorische Bewegungen gefordert.
Parallel dazu verschiebt sich die politische Debatte weiter in Richtung einer restriktiveren Migrations- und Asylpolitik. Mit der Inbetriebnahme einer Abschiebehaftanstalt in Arnstadt verschärft die Landesregierung ihre migrationspolitische Praxis weiter – ein Beispiel für Entrechtung und Abschottung. Auch aus dieser sogenannten Mitte des politischen Spektrums werden Forderungen nach Gesetzesverschärfungen, schnelleren Abschiebungen und einer Ausweitung sicherheitspolitischer Maßnahmen erhoben und umgesetzt. Mittels Bezahlkarten, Kürzungen bei Sozialleistungen und Arbeitspflicht für Geflüchtete wird Menschen gezielt das Leben schwer gemacht. Dieser gesamtgesellschaftliche Rassismus wird von Rechts weiter befeuert. Die AfD-Agenda prägt den Diskurs und die politische Praxis, auch vor offener Zusammenarbeit scheuen sich einige bürgerliche Parteien nicht mehr.
Initiativen, die sich für Demokratie, Antifaschismus oder Menschenrechte einsetzen, geraten derweil verstärkt unter politischen Druck. Die CDU attackiert Förderprogramme gegen Rechtsextremismus und fordert deren Umstrukturierung. Projekte und Träger werden öffentlich als extremistisch bezeichnet, Fördermittel stehen vermehrt infrage, Projekte stehen vor existenziellen Risiken. Im Sinne der Hufeisentheorie, die rechte und linke Akteur*innen auf eine Stufe stellt, geraten auch Gruppen ins Visier, die sich kritisch mit staatlichen Institutionen auseinandersetzen oder sich in der antirassistischen Bildungsarbeit engagieren. Die staatliche Unterstützung für demokratische Strukturen im ländlichen Raum ist vielerorts rückläufig. Besonders betroffen sind Regionen in Ostdeutschland, in denen rechte Akteur*innen bereits über politische Gestaltungsmacht verfügen.
Die neue Bundesregierung zeigt zudem im Kampf gegen Antiziganismus eine alarmierende Ignoranz und verschärft durch ihr Wegsehen die bestehende Diskriminierung von Roma* und Sinti*. Wichtige Forderungen, wie die Einführung eines bundesweiten, verbindlichen Aktionsplans gegen Antiziganismus, wurden ignoriert und im Koalitionsvertrag nicht verankert. Bildungs- und Aufklärungsprojekte, die sich mit der Geschichte und der systematischen Ausgrenzung von Roma* und Sinti* beschäftigen, erhalten weiterhin nur minimale oder gar sinkende Fördermittel. In Thüringen wurde das Amt des*der Antiziganismusbeauftragte*n gestrichen. Statt klarer politischer Prioritäten herrscht eine gefährliche Gleichgültigkeit gegenüber einer der am stärksten marginalisierten Gruppen in Deutschland.
Dazu verdichtet sich unter der Federführung der CDU die Leistungsideologie zu einem verschärften Klassenkampf von oben. Sozialpolitische Maßnahmen und Reformvorschläge folgen verstärkt dem Paradigma von Eigenverantwortung, Disziplinierung und verwertbarer Arbeitskraft. Neben der Verschärfung des Bürgergelds mit mehr Sanktionsmöglichkeiten und rigideren Zumutbarkeitsregelungen rücken arbeitsmarktpolitische Debatten weiter auf die Seite der Kapitalinteressen. So werden etwa Forderungen nach einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten – inklusive der faktischen Aufweichung des Achtstundentags – unter dem Deckmantel der Wettbewerbsfähigkeit diskutiert. Die Interessen von Arbeiter*innen treten dabei weiter in den Hintergrund. Statt die bereits prekäre soziale Absicherung zu verbessern, werden Anpassungsdruck, Kontrollmechanismen und ökonomische Verwertbarkeit als Bedingungen für gesellschaftliche Zugehörigkeit verschärft. Die Zurückdrängung individueller Rechte und die Gewichtung staatlicher Ausgaben zugunsten nationaler Interessen zeigt sich auch bei der fortschreitenden Militarisierung der Politik. Der imperialistische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und ihre Bevölkerung wird dabei zur Rechtfertigung genommen, den deutschen Staat wieder kriegsfähig zu machen.
Deshalb zum Ratschlag 2025 nach Jena!
Die gesellschaftlichen Verhältnisse verschärfen sich: Repression gegen linke Bewegungen, antisemitische Mobilisierungen, queerfeindliche Angriffe, verschärfte Arbeitsmarktpolitik, rassistische Übergriffe, Abschiebungsoffensiven und eine extrem rechte Partei auf dem Weg zur Macht – in dieser Gemengelage stehen wir als Linke unter massivem Druck.
Emanzipatorische Politik, kritische Bildung und antifaschistisches Engagement werden delegitimiert, entpolitisiert oder kriminalisiert. Während Neonazis erstarken und ihre Netzwerke weiter ausbauen, geraten demokratische und solidarische Strukturen unter Rechtfertigungszwang oder drohen an Förderung zu verlieren. Die politischen Verhältnisse, in denen wir kämpfen, werden rauer.
In Jena gibt es mehrere antifaschistische und linke Gruppen und Verbände, die sich der autoritären Formierung, der erstarkenden Rechten, dem rassistischen Normalzustand und den wachsenden antizionistischen Mobilisierungen entgegenstellen. AfD-Events werden blockiert, Bezahlkarten gegen Bargeld getauscht, Solidarität mit Repressionsbetroffenen organisiert, es wird versucht Räume und Häuser zu erobern, um Freiräume für ein besseres Leben zu schaffen und autoritäre Gruppen müssen mit Gegenwind rechnen. Diese Bemühungen wollen wir unterstützen und einen Beitrag zu ihrer Vernetzung leisten.
Umso wichtiger ist es, sich zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen, Strategien weiterzuentwickeln, solidarische Kritik aneinander zu üben und sich gemeinsam zu organisieren. Der antifaschistische und antirassistische Ratschlag versteht sich seit über drei Jahrzehnten als ein solcher Raum: Ort der Vernetzung, der strategischen Diskussion, der gegenseitigen Unterstützung. Die Notwendigkeit, diese Räume zu stärken, war selten so dringlich wie heute. Im November 2025 kommen in Jena Aktive aus Antifa- und Antira-Zusammenhängen, aus Gewerkschaften, Jugendverbänden, Bürger*inneninitiativen, politischen Organisationen und selbstorganisierten Strukturen zusammen, um aktuelle Entwicklungen zu analysieren und gemeinsame Antworten zu diskutieren. Die Vergangenheit zeigt, dass Rechte und andere Menschenfeinde immer dort aufsteigen konnten, wo antifaschistische Kräfte marginalisiert, zersplittert oder entpolitisiert waren. In einem gesellschaftlichen Klima, in dem Menschenverachtung offen artikuliert werden kann, indem die Shoah relativiert und rechter Terror bagatellisiert wird, ist antifaschistisches Engagement nicht nur notwendig, sondern überlebenswichtig.
Wir laden alle ein, die sich einer Politik der Entrechtung, der Angst und des Ausschlusses widersetzen wollen. Alle, die den gesellschaftlichen Rechtsruck nicht hinnehmen, sondern ihm solidarische, reflektierte und entschlossene Theorie und Praxis entgegensetzen wollen, ohne dabei die emanzipatorische Zielsetzung einer Gesellschaft aus den Augen zu verlieren, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können. Es ist Zeit, sich zu organisieren!
Wir laden alle ein, die sich einer Politik der Entrechtung, der Angst und des Ausschlusses widersetzen wollen. Alle, die den gesellschaftlichen Rechtsruck nicht hinnehmen, sondern ihm solidarische, reflektierte und entschlossene Theorie und Praxis entgegensetzen wollen, ohne dabei die emanzipatorische Zielsetzung einer Gesellschaft aus den Augen zu verlieren, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können. Es ist Zeit, sich zu organisieren!
Kommt am 7. und 8. November 2025 nach Jena!