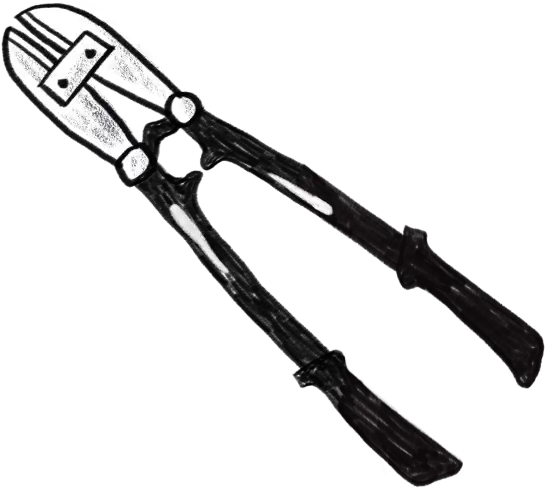Für den diesjährigen antirassistischen und antifaschistischen Ratschlag in Jena haben wir uns im Vorfeld intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir mit den aktuellen Spaltungen innerhalb der Linken im Hinblick auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas umgehen wollen. Unser Ziel war es, einen Raum zu schaffen, der Kraft gibt und zur Selbstermächtigung beiträgt – und zugleich ein Ort ist, an dem wir trotz aller Unterschiede wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen können. Denn wir nehmen in Jena eine wachsende Sprachlosigkeit und Ohnmacht wahr: Viele Menschen fühlen sich angesichts der Situation im Nahen Osten, aber auch der harten und teils spaltenden Debatten innerhalb der Linken, überfordert und isoliert. Dem möchten wir etwas entgegensetzen.
Wichtig ist uns: Wir haben in unseren internen Diskussionen weder einen Konsens gefunden noch wollten wir eine gemeinsame Lösung für den Nahostkonflikt erarbeiten. In der Debatte um getragene Symbole und vertretene Positionen ist für uns nicht nur entscheidend welches Symbol gezeigt wird, sondern auch mit welcher Motivation es getragen oder genutzt wird.
Aus diesem Grund haben wir unseren Blick stärker auf die Frage gerichtet, wie wir miteinander in den Austausch treten. Der Ratschlag soll ein Ort der Weiterbildung und des Dialogs sein. Dafür halten wir es für unverzichtbar, dass alle Beteiligten die Bereitschaft mitbringen, einander zuzuhören und verstehen zu wollen – ohne zwangsläufig einverstanden sein zu müssen. Um nicht selbst in autoritäre „Freund-Feind“-Gegensätze oder geschlossene, Weltsichten zu verfallen, braucht es auch die Bereitschaft, Widersprüche auszuhalten. Gleichzeitig wissen wir, dass die Grenze dessen, was aushaltbar ist, nicht eindeutig bestimmbar ist: Sie hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel von individuellen Erfahrungen und Positionierungen.
Uns ist bewusst: Einen vollkommen „sicheren Raum“ können wir mit dem Ratschlag nicht garantieren. Wann und wodurch Angsträume entstehen oder wann wir aufgrund unserer Entscheidungen unbeabsichtigt Personen ausschließen, können wir nicht im Vorhinein vollständig absehen. Dennoch übernehmen wir als Orga Verantwortung. Personen des Orga-Teams sind jederzeit ansprechbar und wollen sicherstellen, dass Menschen ernst genommen werden. Außerdem gibt es ein geschultes Awareness-Team, an das Menschen sich wenden können, wenn sie sich unwohl fühlen. Unser Ziel ist, gemeinsam für eine Atmosphäre zu sorgen, in der sich alle möglichst sicher bewegen können. Gleichzeitig heißt das auch: Wir dulden keine gezielten Provokationen, die nicht auf einen inhaltlichen Austausch abzielen. Personen, die absichtlich stören, werden von der Veranstaltung ausgeschlossen.
Mit großer Sorge beobachten wir den zunehmenden Antisemitismus und Antizionismus in der Linken – sowie die Gefahr, dass die Kritik daran nicht mehr als selbstverständlicher Teil linker Politik verstanden wird. Aus diesem Grund ziehen wir eine klare rote Linie zum Beispiel bei: Territorialkarten ohne Israel oder Sprüchen, die dieses nahelegen; beim Tragen von dem von der Hamas genutzten roten Dreieck; und bei positiven Bezügen auf Organisationen wie Hamas, PIJ, die Abu-Ali-Mustafa-Brigaden, die PFLP oder Leila Khaled. Das Tragen von Kufiyas ist eine schwierige Grauzone. Sie sind politisch stark aufgeladen und wir sehen sie aus diesem Grund kritisch. Wir erkennen jedoch, dass sich Bedeutungen von Symbolen wandeln können und dass nicht alle, die eine Kufiya tragen, diese mit antisemitischen oder eliminatorischen Positionen vertreten. Deshalb haben wir uns entschieden, sie nicht grundsätzlich zu verbieten. Zugleich erwarten wir aber, dass diejenigen, die sie tragen, auch Kritik daran aushalten und den Dialog darüber führen wollen.
Außerdem sehen wir, dass es in der Mehrheitsgesellschaft eine zunehmende Instrumentalisierung von Antisemistismuskritik für rassistische Stimmungsmache und Politiken gibt. Wir finden, Kritik muss sich an den eigenen Ansprüchen messen lassen. Dort, wo sie verroht oder menschenfeindlich wird, ziehen wir eine rote Linie, wie zum Beispiel auch Territorialkarten ohne die palästinensischen Autonomiegebiete oder Memes, wie das eines Hundes, der eine Wassermelone frisst, sind für uns daher nicht tragbar. Es ist unserer Ansicht nach Aufgabe der Linken beides nicht gegeneinander auszuspielen.
Das Ratschlag-Vorbereitungsbündnis verurteilt Gewaltandrohungen, wie sie von Teilnehmer*innen der pro-palästinensischen Kundgebung am 10.7.2025 in Jena ausgegangen sind. Unabhängig davon, wie man sich in diesem Konflikt positioniert, ist es inakzeptabel, innerlinke politische Differenzen durch physische Gewalt oder deren Androhung lösen zu wollen.
All diese Überlegungen sind Ausdruck unseres gemeinsamen Ringens mit einer komplexen Situation. Wir wollen mit dem Ratschlag Räume öffnen, in denen Austausch möglich bleibt – klar in der Haltung gegen Antisemitismus und menschenfeindliche Positionen, zugleich aber mit der Bereitschaft, Differenzen und Widersprüche auszuhalten. Unser Anspruch ist es, Verantwortung zu übernehmen, Gesprächsräume offenzuhalten (oder wieder zu öffnen) und gemeinsam daran zu arbeiten, dass der Ratschlag ein Ort des Lernens, der Solidarität und des Miteinanders bleibt.